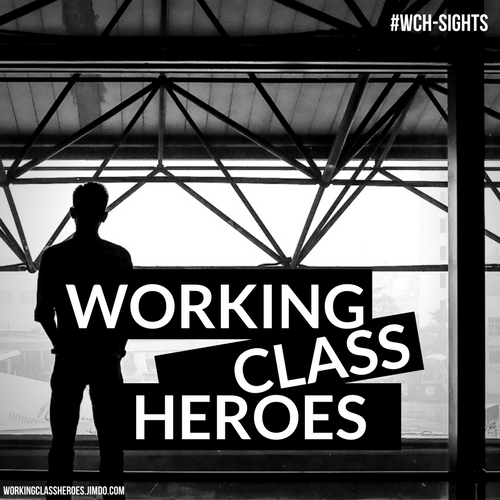Die wachsende Wirtschaft lässt das Kapital der Natur schrumpfen.
Die «imperiale Lebensweise» beutet nicht nur die Natur aus. Sie vergrössert auch die soziale Kluft zwischen Norden und Süden.
Die wachsende Wirtschaft lässt das Kapital der Natur schrumpfen. Das wissen wir seit 1972, als Donella und Denis Meadows ihr Buch «Die Grenzen des Wachstums» veröffentlichten. Heute beansprucht die Menschheit bereits anderthalb Mal so viele natürliche Ressourcen, wie unser Planet regenerieren kann. Das zeigt die globale Naturbuchhaltung, die der Schweizer Mathis Wackernagel mit seinem «Global Footprint Network» erstellte und jährlich aktualisiert. Dabei vergleicht er den ökologischen Fussabdruck mit der natürlichen Biokapazität der Erde, beides gemessen in fruchtbaren Hektaren Fläche pro Durchschnitts-Person und Jahr. Soviel zur Menge des globalen Naturverbrauchs.
Naturtransfer: Norden zehrt vom Süden
Nun zur Verteilung. An der Ausbeutung des schrumpfenden Naturkapitals partizipiert die Welt in unterschiedlichem Mass: Am grössten ist der ökologische Fussabdruck in Nordamerika, gefolgt von Europa, am kleinsten in Afrika. So beansprucht eine Person in den USA die Natur im Schnitt zehnmal stärker als eine Person in der rohstoffreichen Republik Kongo. Noch grösser ist die Differenz zwischen Personen, die in den USA oder Europa zur Oberschicht gehören, und armen Leuten in Asien und Afrika.
Dazu kommt: Nicht alle Staaten verfügen pro Kopf der Bevölkerung über gleich viel Biokapazität. Im dicht besiedelten Europa oder in China ist der ökologische Fussabdruck der dort lebenden Bevölkerung doppelt so hoch wie die natürliche Kapazität ihres Territoriums. Die ökologischen Schuldnerstaaten im Norden übernutzen damit nicht nur ihre eigene Natur auf Kosten von nachfolgenden Generationen. Sie plündern zusätzlich die Natur im Süden (von der Rohstoffausbeutung bis zur Landaneignung) oder missbrauchen ihn als Halden und Senken für ihre Abfälle (von Elektroschrott bis zum CO2). Daraus entsteht ein ökologischer Transfer von Süden nach Norden.
Wirtschaftliches Gefälle oder: Wenn alle so lebten wie wir
Die Ausbeutung des Südens durch den Norden beschränkt sich nicht auf den Naturverbrauch. Noch ausgeprägter ist das wirtschaftliche Gefälle: Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf der Bevölkerung ist in den westlichen Industriestaaten vier bis zehn Mal so hoch wie im Weltdurchschnitt und über 50 Mal so hoch wie in den ärmsten Ländern Afrikas und Asiens.
Oder ein anderer Vergleich: Wenn alle 2,4 Milliarden Inderinnen und Chinesen so wirtschaften wollten, wie die 0,8 Milliarden Europäer und US-Amerikanerinnen es tun, so müssten sie ihr BIP pro Kopf im Schnitt um den Faktor acht erhöhen. Wie stark dieses – nach der Maxime der Gleichberechtigung legitime – Wachstum unseren Planeten zusätzlich belasten würde, mögen sich die Lesenden selber ausmalen.
«Imperiale Lebensweise» – exklusiv oder tot
Als «imperial» bezeichnen und beschreiben die beiden Autoren die Lebensweise, die sich die meisten Menschen «im globalen Norden» sowie eine wachsende Minderheit von Menschen im «globalen Süden» leisten. Sie zeichnet sich aus durch hohen Wohnstandard, Autobesitz, Fernreisen, bevorzugt im Flugzeug, sowie üppigen Konsum von weiteren Gütern und Dienstleistungen.
Die Beschreibung dieses für uns längst alltäglich und selbstverständlich gewordenen Wohlstandslebens, verknüpft mit dem Begriff Imperialismus, öffnet eine neue politische Sicht auf schon bekannte Informationen. Und sie führt uns wieder einmal vor Augen, dass das Private politisch ist. Die Art, wie wir kollektiv produzieren und individuell konsumieren, führt wie eingangs skizziert zu globaler Übernutzung der natürlichen Lebensgrundlagen, zur Umverteilung von Naturkapital zu Gunsten des Nordens sowie von Abfällen zu Lasten des Südens, und sie stützt das wirtschaftliche Gefälle zwischen arm und reich.
Unsere Lebensweise beruht also auf Exklusivität – eine Exklusivität, welche die Profiteure auf keinen Fall preisgeben wollen: «Der amerikanische Lebensstil ist nicht verhandelbar», sagten US-Präsidenten, schon bevor Donald Trump mit dem Slogan «America first» antrat. Die «Erhaltung unseres Wohlstands» gilt als oberste Maxime von Regierungen, Parlamenten und den meisten Medien auch in der Schweiz.
Diese Form von Wohlstand erscheint heute als derart attraktiv, dass der überwiegende Teil der Weltbevölkerung daran teilhaben möchten, sei es durch wirtschaftlichen Aufstieg in den Entwicklungs- und Schwellenländern des Südens, sei es mittels Emigration nach Norden. Doch je mehr Menschen das gelingt, «desto eher geht der imperialen Lebensweise die Geschäftsgrundlage verloren», formulieren die Autoren, weil unsere Lebensweise global nicht verkraftbar und damit nicht verallgemeinerbar ist. Diesen paradoxen Sachverhalt spitzen sie an anderer Stelle zu: «Die imperiale Lebensweise ist derzeit im Begriff, sich zu Tode zu siegen.»
Grüne Wirtschaft als «falsche Alternative»
Der Konflikt zwischen sich ausbreitendem materiellen Wohlstand und schrumpfendem Naturkapital lässt sich entschärfen, wenn wir Energie und andere Naturgüter effizienter nutzen, Stoffkreisläufe schliessen, von Kohle und Öl auf Sonnen- und Windenergie und von Otto- auf Elektromotoren umsteigen. Diese Meinung vertreten Wissenschaftlerinnen, Technokraten, Regierungen, die meisten Ökonomen, und selbst Umweltverbände hegen diese Hoffnung.
«Grüne Ökonomie» ist eine «falsche Alternative», entgegnen Ulrich Brand und Markus Wissen. Denn:
Ein «grüner Kapitalismus» würde «die imperiale Lebensweise nicht grundsätzlich in Frage stellen». Gerade das sei aber nötig, denn diese Lebensform ist nicht nur ökologisch fatal.
Sie enthält und verstärkt auch ökonomische, politische und soziale Konflikte. Die Autoren schreiben wiederholt von einer «multiplen Krise», und sie warnen mit linkem Slang davor, diese Krise von einzelnen Interessengruppen ausschlachten zu lassen: «Wir erleben, dass die multiple Krise bestenfalls grünkapitalistisch, tendenziell aber autoritär, neoliberal oder rechtsextrem bearbeitet und damit die imperiale Lebensweise verteidigt wird.»
Analyse ausgezeichnet, Auswege schwammig
Im letzten Kapitel unter dem Titel «Konturen einer solidarischen Lebensweise» skizzieren Brand und Wissen Wege, um die imperiale Lebensweise zu überwinden. Als Leser der voran gehenden Informationen und Analysen hätte man an dieser Stelle zum Beispiel ein Plädoyer für ein Existenzmaximum erwarten können, welches die Lebensgrundlagen unseres Planeten nicht übernutzt und damit weit unter dem heutigen Konsumstandard in den westlichen Industriestaaten liegen müsste, sowie Vorschläge, wie und mit welchen Mitteln dieser kleinere Kuchen global gerecht verteilt werden kann.
Doch im vorliegenden Buch bleibt das abschliessende Kapitel abstrakt, unverbindlich und schwammig. «Veränderungen müssen an verschiedenen Punkten ansetzen», heisst es etwa, ohne dass diese Punkte konkretisiert werden. Oder: Statt sich den falschen Wohlstandsversprechen zu ergeben, gelte es, «Formen des gerechten, solidarischen und nachhaltigen Wohlstands zu schaffen und zu leben», was immer das heissen mag. Dort, wo die Rezepte einmal konkret werden, wirken sie herzig (Coca-Cola-Automaten aus der Schule verbannen, urban-gardening, Tierrechte stärken etc.) oder altbacken (Ausstieg aus der Kohle, Klimagerechtigkeit).
Der Report über die «Imperiale Lebensweise» stösst damit an die gleichen Grenzen wie andere Sachbücher, welche die Lage der Menschheit thematisieren: Das globale Wachstums- und Verteilproblem wird inhaltlich breit und formal brillant analysiert, die Vorschläge zur Lösung des Problems aber sind schwach.